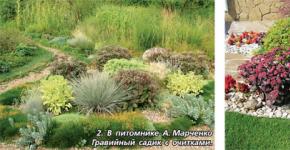Teppich aus der Kathedrale von Bayeux. Teppich aus Bayeux – welche Filme wurden im Mittelalter geschaut
Wo befindet sich: Bayeux (Normandie), das Museum ist vom Tourismusbüro aus zu erreichen: zuerst nach Süden entlang der Rue Larcher bis zur Kreuzung mit der Rue de Nesmond und dann entlang dieser nach Westen bis zur Hausnummer 13.
Wie funktioniert es: von Mitte September bis April 9.00 / 9.30-12.30 und 14.00-18.00 Uhr; den Rest des Jahres bis 19.00 Uhr. Es wird empfohlen, einen Audioguide (auf Russisch verfügbar) mitzunehmen.
Ticket Preis: 7,80 Euro.
Webseite
Was man sich ansehen sollte: Der Bayen-Wandteppich ist ein etwa 70 m langer und 50 cm breiter Streifen aus grobem Leinenstoff, auf den mit mehrfarbiger Wolle die Geschichte der Eroberung Englands durch die Normannen unter der Führung Wilhelms gestickt ist.
Herstellungsgeschichte.
Es wurde zwischen 1066 und 1082 hergestellt. Der genaue Auftraggeber des Werkes ist unbekannt. Es gibt drei Versionen.
Nach traditioneller Auffassung wurde der Teppich im Auftrag bestickt Königin Matilda, die Frau von Wilhelm dem Eroberer, ihren Hofwebern. In Frankreich ist der Teppich als „Königin-Mathilden-Teppich“ bekannt. (Biographie der Königin)
Im 20. Jahrhundert wurde eine weitere Hypothese aufgestellt: Der Kunde für die Herstellung des Teppichs könnte sein Odo, Bischof von Bayeux, Halbbruder und einer der engsten Mitarbeiter von König Wilhelm I. Als Bestätigung dieser These werden üblicherweise folgende Fakten angeführt:
Der Teppich zeigt drei Diener des Bischofs, deren Namen auch im Buch des Jüngsten Gerichts enthalten sind;
Der Teppich wurde in der von Odo erbauten Kathedrale von Bayeux aufbewahrt. Möglicherweise entstand der Teppich zur Zeit des Baus der Kathedrale (1070er Jahre) und war wahrscheinlich für deren Dekoration gedacht.
Für den Fall, dass Bischof Odo tatsächlich der Kunde des Teppichs war, handelte es sich bei seinen Urhebern wahrscheinlich um englische Weber, da sich der Hauptgrundbesitz des Bischofs in Kent befand. Dies wird indirekt durch die Tatsache bestätigt, dass einige der lateinischen Namen auf dem Teppich von angelsächsischen abgeleitet sind und die zur Herstellung des Teppichs verwendeten Pflanzenfarben in England weit verbreitet waren.
Die schwierigere Frage ist, wer der Designer des Bildes war. Betrachtet man den gesamten Wandteppich als Ganzes, wird deutlich, dass er einen großen Sieg verherrlicht. Und es ist klar, dass die Urheberschaft der Idee einer Person gehört. Wer könnte es sein – ein Mann oder eine Frau? Höchstwahrscheinlich ein Mann, ein direkter Teilnehmer an den Ereignissen. Die Kampfszenen auf dem Wandteppich sind sehr anschaulich und mit blutigen Details dargestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass eine Dame über solche Details Bescheid weiß, ohne mitten im Geschehen zu sein.
Der Wandteppich besteht aus acht einzelnen, der Länge nach zusammengefügten Leinenstücken. Es wird angenommen, dass zunächst ein Muster auf den Stoff aufgetragen, dann gestickt und erst danach zu einer einzigen Leinwand zusammengefasst wurde. Insgesamt werden 58 Szenen in chronologischer Reihenfolge nacheinander auf den Stoff aufgebracht. Jeder von ihnen ist mit Kommentaren in „Hunde“-Latein versehen. Die Gemälde reproduzieren sorgfältig Waffen, Werkzeuge und sogar traditionelle Lebensmittel der Normannen und Sachsen. Die Sachsen auf dem Wandteppich sind mit Schnurrbärten und die Normannen mit kahlgeschorenen Köpfen dargestellt. Im Jahr 1066 näherte sich der Halleysche Komet der Erde – er ist auch auf dem Wandteppich eingestickt. Es ist ersichtlich, dass mindestens 7 m verloren gingen, bevor der Wandteppich länger war, also über 1000 Jahre seines Bestehens. Wie, wann und warum ein Teil verloren ging, ist unbekannt. Es stellte wahrscheinlich Ereignisse nach der Schlacht von Hastings dar, darunter die Krönung Wilhelms des Eroberers, die am Weihnachtstag 1066 stattfand. Möglicherweise stellte es seine Ankunft in London und die Errichtung des Towers dar.
Nach sorgfältiger Untersuchung des Wandteppichs kamen Historiker zu dem Schluss, dass ihn nur zwei Personen mit vier Händen gewebt haben. Es gibt nirgendwo auf der Welt etwas Vergleichbares wie den Teppich von Bayeux – selbst wenn er vor nicht tausend, sondern vor zwanzig Jahren gestickt worden wäre, hätte er viele bewundernde Zuschauer angezogen.
Interessante Fakten.
Der Wandteppich zeigt:
- 623 menschliche Figuren;
- 55 Hunde;
- 202 Pferde;
- 41 Schiffe;
- 49 Bäume;
- fast 2000 lateinische Wörter;
- mehr als 500 mythische Charaktere (wie Drachen);
- Sie können mindestens 8 Farbtöne von Wollfäden unterscheiden: Lila, Blau, Grün und Schwarz;
- Beim Sticken wurden die Kettenstichtechnik, die Stielstichtechnik sowie ein einfaches „Set“ verwendet.
Geschichte des Wandteppichs.
Nach der Fertigstellung des Teppichs wurde er nach Bayeux gebracht und in der von Bischof Odo errichteten Kathedrale Notre Dame ausgestellt. Es ist bekannt, dass sich der Wandteppich mehr als 400 Jahre lang an den Wänden der Kathedrale befand – dies wird deutlich, wenn man das Inventar des damaligen Kirchenbesitzes untersucht. Der früheste schriftliche Nachweis eines Teppichs findet sich in einem Inventar der Kathedrale Notre-Dame in Bayeux aus dem Jahr 1476. Die Inventare wurden für die nächsten dreihundert Jahre nicht aufbewahrt, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Wandteppich an seinem Platz verblieb. Die ersten Reproduktionen des Teppichs wurden in den 1730er Jahren veröffentlicht. Bernard de Montfaucon. 1750 wurde er zum Studium nach England in die historische Gemeinde Palaeographia Britannicus geschickt. Bei seiner Rückkehr war der Wandteppich in Gefahr. Während der Französischen Revolution wollten einige Republikaner aus Bayeux aus dem Teppich eine Abdeckung für einen Wagen mit Militärmunition herstellen, aber der Anwalt Lambert Leonard Leforestier, der den Wert des Teppichs erkannte, rettete ihn, indem er einen anderen Stoff zur Verfügung stellte.
Im Jahr 1803 brachte Napoleon den Teppich nach Paris, um die geplante französische Invasion in England zu fördern. Als der Invasionsplan jedoch scheiterte, wurde der Teppich nach Bayeux zurückgebracht. Dort wurde es aufgerollt gelagert, wobei sich die Stickerei dadurch zwar dehnte, aber zumindest war der Wandteppich sicher. Im Jahr 1818 zeigten die Briten Interesse an dem Meisterwerk. Ein Restaurator traf ein, der den Wandteppich mehr als zwei Jahre lang studierte und einen Restaurierungsplan ausarbeitete, doch der Tod hinderte ihn daran, mit der Umsetzung fortzufahren. Die Restaurierung erfolgte jedoch dennoch im Jahr 1842. Gleichzeitig wurde der Wandteppich erstmals unter Glas platziert. 1870 wurde es erneut zusammengerollt und versteckt – es herrschte Deutsch-Französischer Krieg, niemand wollte ein Risiko eingehen. Zwei Jahre später präsentierte sich das Meisterwerk erneut der Welt. Bis 1913 war es für die Öffentlichkeit zugänglich, dann zwang der Ausbruch des Ersten Weltkriegs die Einwohner von Bayeux erneut dazu, den Teppich zusammenzurollen und in Verstecken zu verstecken. Dasselbe taten die Behörden im Zweiten Weltkrieg, da sie den Wunsch der Nazis kannten, in den eroberten Gebieten Kunstwerke zu sammeln. Daher verbrachte der Teppich die meiste Zeit des Krieges in den Kerkern des Louvre. Nach der Kapitulation Deutschlands wurde der Wandteppich in seiner ganzen Pracht in Paris ausgestellt. Ein Jahr später kehrte er nach Bayeux zurück.
Derzeit wird der Teppich in einem speziellen Museum in Bayeux (dem ehemaligen Priesterseminar und jetzt dem „Centre Guillaume the Conqueror“) ausgestellt und, um eine Verschlechterung dieses Kunstwerks zu vermeiden, wird er unter Glas und besonders niedrig platziert Die Beleuchtung im Raum bleibt erhalten.
Handlung
Die Geschichte von König Harold und Wilhelm dem Eroberer ist jedem Schulkind bekannt – im Jahr 1066 kämpfte der englische Herrscher Harold in Hastings mit einem Eindringling, einem normannischen Wilhelm, der zu Besuch war. Harold starb in der Schlacht, die Sachsen wurden besiegt und in England saß der Herzog der Normandie auf dem Thron. Die Schlacht war historisch – nicht umsonst wird sie seit vielen Jahrhunderten in Romanen und Balladen besungen: „ Der Abt von Waldham seufzte schwer, überwältigt von der Nachricht, dass der sächsische Anführer, König Harold, in Hastings ehrenvoll gefallen war.".
Im Museum, auf dem Weg zum Wandteppich, betrachten die Besucher die Wachsfiguren von Guillaume und seinen Kriegern, Schlachtkarten, Pläne und viele andere Exponate zu ähnlichen Themen, die Besichtigung scheint endlos – aber am Ende steht man davor die Tür mit dem geschätzten Wort „Wandteppich“. Und gleichzeitig ist man völlig unvorbereitet, dieser erstaunlichen Schöpfung zu begegnen – das kann man sich im 11. Jahrhundert nicht vorstellen. So aufschlussreich und witzig ließen sich historische Ereignisse veranschaulichen. Der Wandteppich ist in einem schwarzen, durch Glas geschützten und gut beleuchteten Raum ausgebreitet – alle 58 Szenen sind der Geschichte von Harold und Guillaume gewidmet, der Geschichte, wie der Führer freundlich erklärt, von Verrat und Meineid. Jede Szene wird von eher ätzenden Inschriften in lateinischer Sprache begleitet, auf Erklärungen kann man aber grundsätzlich verzichten. Harold und andere Engländer sind an ihren üppigen Kakerlakenbärten zu erkennen, während die normannischen Krieger auf dem Wandteppich glattrasiert erscheinen. Die Geschichte beginnt lange vor Hastings – und erzählt von Freundschaft und Brüderlichkeit zwischen zukünftigen Feinden. Den Franzosen zufolge half Guillaume Harold beim Kampf, befreite ihn aus der Gefangenschaft und bat nur um eines: nicht den englischen Thron zu besetzen. Der verräterische Harold (und glauben Sie Heine danach!) brach sein Versprechen, und die Normannen, angeführt von Guillaume, unternahmen einen langen Feldzug, um den anmaßenden König in die Schranken zu weisen. Die Szenen der Truppensammlung, des Enterns von Schiffen und der Landung in England sind vielleicht die stärksten im gesamten Wandteppich, besonders die gestickten Pferde und die aufwändige Gestaltung der Waffen fallen ins Auge. Und auch wenn die Farben mit der Zeit etwas verblasst sind, überrascht die Leinwand immer noch mit leuchtenden Farben und äußerst präzisen Bildern. Vor der ersten Entdeckung durch Archäologen in den Sümpfen bei Schleswig im Jahr 1862 durch das Boot der berühmten Wikinger wussten Historiker von ihrem Aussehen nur aus den Beschreibungen von Tacitus und ihren Bildern auf dem Teppich von Bayeux!
Wie jeder weiß, starb König Harold auf dem Schlachtfeld – der Pfeil des normannischen Kriegers traf ihn ins Auge, und der darauffolgende Tod löste bei den sächsischen Truppen Panik aus. Der Schauplatz seines Todes wird sehr oft auf Souvenirs aller Art „zitiert“, die in Bayeux buchstäblich auf Schritt und Tritt verkauft werden. Tassen, Schachteln mit Butterkeksen, Mauspads und sogar ein DIY-Stickset sind alle mit bekannten Motiven verziert. Die Franzosen sind auf den Teppich von Bayeux genauso stolz wie auf Wilhelm den Eroberer – schließlich ist er für die Engländer der Eroberer und für die Franzosen der Held und König Guillaume. Moderne Modedesigner haben auf ein Beispiel antiker Stickereien aufmerksam gemacht: In den Sommerkollektionen gibt es Damenschals aus Seide, die mit Fragmenten der Handlung des Teppichs von Bayeux verziert sind.
Eigentlicher Wandteppich.
König Edward. Harold, Herzog von England, und sein Gefolge reiten nach Bosham.
König Edward der Bekenner von England übertrug 1064 seinem Untertanen Herzog Harold die unangenehme Aufgabe, in die Normandie zu reisen, um dem Herzog der Normandie Wilhelm Tribut zu zollen. Die Demütigung des Ereignisses für Harold wurde durch die Tatsache verstärkt, dass Edward und William 1051 eine Vereinbarung schlossen, wonach der Thron nach Edward an den Herzog der Normandie gehen würde. Harold nutzte seine Mission jedoch für persönliche Zwecke – er organisierte die Freilassung seiner Neffen Wulfnot (Wulfnot) und Harkon (Harkon). Leider geriet das Schiff, auf dem Harold an die Küste der Normandie fuhr, in einen schweren Sturm und der arme Herzog wurde von einem gewissen Guy von Ponthieu gefangen genommen. Achten Sie auf die damalige Mode für Schnurrbärte.
Kirche. Von hier aus macht sich Harold auf den Weg zur See ...
... mit vollen Segeln in das Gebiet des Grafen Guy zu segeln.
Harold. Guy nimmt Harold gefangen und schickt ihn nach Beaurain, wo er ihn mit Gewalt festhält.
Harold und Guy unterhalten sich.
Der Gesandte Herzog Wilhelms trifft bei Guy ein.
Guys Gesandte treffen bei Herzog Wilhelm ein.
Guy Pontue informiert William, dass er Herzog Harold gefangen genommen hat. Bis heute bleibt die Frage offen, ob für den Gefangenen ein Lösegeld gezahlt wurde. Manche sagen, Wilhelm habe sich Mühe gegeben, einen edlen Gefangenen zu befreien. Andere glauben, dass er sich kategorisch weigerte. Er drückte Guy leicht mit der Methode einer zarten Drohung und versuchte, ihn von der Täuschung seines Verhaltens zu überzeugen.
Guy bringt Harold zu William, dem Herzog der Normandie.
Die Szene auf dem Wandteppich zeigt den Moment der Übergabe von Herzog Harold an William. Auf der linken Seite gehen wir davon aus, dass es sich um Guy handelt, der auf Harold zeigt und sich an Wilhelm wendet, der rechts steht.
Herzog Wilhelm kommt mit Harold in seinem Schloss an. Hier ist ein gewisser Kirchendiener und Aelfgiva (Aelfgyva).
Wilhelm und Harold diskutieren aktuelle Themen. Viele Treffen wie dieses wurden organisiert. Diese Männer waren auch im Geheimdienst würdige Rivalen, daher muss es für sie interessant gewesen sein, einander zuzuhören. Harold verstand, dass er tatsächlich eine Geisel war, also musste er bei diesen Treffen sehr vorsichtig sein, sodass Harold und Wilhelm gute Freunde wurden und Seite an Seite kämpften. Es wurde angenommen, dass Harold, falls er jemals nach England zurückkehren würde, sofort einen Treueid auf William leisten würde.
Herzog Wilhelm und sein Heer erreichen den Mont Saint-Michel.
Sie überqueren den Fluss Cuesnon.
Herzog Harold holt sie aus dem Sand.
Und gemeinsam erreichen sie Dol (Dol) und Conan flieht.
Rennes.
Die Soldaten Herzog Wilhelms kämpfen gegen die Bevölkerung von Dinan und Conan übergibt die Schlüssel.
Wilhelm gibt Harold eine Waffe.
Wilhelm kommt in Bayeux an.
Harold leistet Herzog William einen Treueid.
Harold erkennt, dass er keine andere Wahl hat, als Wilhelm die Treue zu schwören, wenn er jemals nach Hause kommen und Wulfnoth und Harkon befreien will. Die Szene zeigt einen Gottesdienst vor heiligen Reliquien. Es war das Letzte, was er tun wollte. Als schlauer Politiker nutzte er diesen Treueeid sogar zu seinem Vorteil. Er hat es zum Beispiel unter Druck gesetzt und in tatsächlicher Gefangenschaft, daher hat dieser Eid keine Rechtskraft. Doch vorerst wurde Harolds Ziel erreicht: Harkon, sein Neffe, folgte seinem Onkel nach England. Sein Bruder Valfnot wurde aus offensichtlichen Gründen als Geisel gehalten.
Herzog Harold kehrt nach England zurück.
Und er kam zu König Edward. König Edward im Bett im Gespräch mit seinen Untertanen. Und hier stirbt er.
Der Leichnam von Edward dem Bekenner wurde nach Westminster überführt, wo er begraben wurde, denn die Abtei wurde von ihm erbaut. Nun sind die Ereignisse, die zehn Monate später folgten, unumkehrbar geworden.
Harold wird die Königskrone überreicht.
Jetzt auf dem Thron von England – Harold.
Die Leute bewundern den Stern.
Eduard der Bekenner starb am 6. Januar 1066. Einer der Charaktere in dieser Szene muss Harold sein, denn Edwards letzte Worte waren: „Ich vertraue meine Frau Ihrer Obhut an und mit ihr mein ganzes Königreich.“ Ob diese Worte tatsächlich von Edward gesprochen wurden, ist noch fraglich. Wenn ja, dann können sie unterschiedlich interpretiert werden. Harold hatte keine Zweifel.
Am Tag nach dem Tod von Eduard dem Bekenner wurde Harold in der Westminster Abbey gekrönt. Er war der erste König, der an diesem Ort thronte. Zu seiner Linken steht Stigand, der exkommunizierte Erzbischof von Canterbury, der zusammen mit den Godwins die Krönung ermöglichte.
Der Halleysche Komet wurde erstmals am 24. April 1066 gesehen. Die Sachsen hielten es für ein schlechtes Omen. Es wurde berechnet, dass der Komet damals viel heller war als im Winter 1985. Es ist klar, dass damals jede Himmelsanomalie als Zeichen Gottes galt, das zur Unterstützung oder Warnung geschickt wurde. Im Mittelalter wurde Omen große Bedeutung beigemessen.
Harold wird vor einem Kometen gewarnt.
Ein englisches Schiff landet auf dem Land des Herzogs Wilhelm.
Wilhelm befiehlt den Bau eines Schiffes.
Die Nachricht von Harolds Krönung verärgert Wilhelm. Er überzeugt seine Grafen und Barone, sich ihm bei diesem Kreuzzug anzuschließen. Darüber hinaus wirbt er um die Unterstützung des Papstes. So beginnen die Vorbereitungen für die Eroberung Englands. Die Szene zeigt den Bau von Schiffen. Beachten Sie, wie ähnlich sie Wikingerbooten sind.
Schiffe werden zu Wasser gelassen.
Menschen laden Waffen auf Schiffe.
Achten Sie auf die auf Stangen getragenen Kettenhemden – sie verraten uns, wie schwer sie waren. Sie tragen auch Schwerter. Der Wagen rechts enthält ein Fass Wasser oder sogar Wein. Über allem stehen Speere und Helme.
Wilhelm überquert das Meer auf einem großen Schiff...
Wilhelm schloss sich seiner Flotte in St. Valery sur Somme an und wartete auf ideale Bedingungen, um den Ärmelkanal zu überqueren und mit der Eroberung zu beginnen.
... und kommt in Pevensey an.
Williams Armee landet in Pevensey. Dieser Prozess verlief nicht gut. Erstens war der Boden in diesem Gebiet aufgrund häufiger Überschwemmungen zu sumpfig. Und zweitens hatte Wilhelm das Pech, in den Schlamm im Gesicht zu fallen (im wahrsten Sinne des Wortes), was damals als schlechtes Omen galt. Der Herzog beeilte sich jedoch, den Gedanken an Zeichen aus seinem Kopf zu verbannen, doch es wird immer noch angenommen, dass nur ein kleiner Teil seiner Truppen an diesem Ort auf dem Boden landete, um Hastings zu erreichen. Der Rest blieb auf den Schiffen und segelte 20 km nach Osten, um dort ihren Anführer zu treffen.
Die Pferde landen am Ufer.
Und die Soldaten eilen nach Hastings, um den Einheimischen Lebensmittel zu enteignen.
Endgültige Landung der Schiffe in Hastings. Wilhelm kümmerte sich umgehend um den Bau hölzerner Schutzkonstruktionen, die zerlegt auf die Schiffe gebracht wurden. Sie wurden auf Felskuppen aufgestellt. Sein skandinavisches Blut machte sich erneut bemerkbar, als die Taktiken der Wikinger zum Einsatz kamen.
Wadard.
Das Fleisch wird zubereitet. Diener decken die Tische.
Abendessen.
Bischof Odo segnet Essen und Wein.
Wilhelm.
Robert.
In Hastings.
Wilhelm erhält Neuigkeiten über Harold.
Das Haus wird in Brand gesteckt.
Dieses Bild zeigt Wilhelm, wie er etwas über Harold, seinen Aufenthaltsort und die Wahrscheinlichkeit seines Sieges an der Stamford Bridge erfährt. Auf der rechten Seite zünden die Normannen ein Haus an, eines von vielen, die in den eroberten Gebieten niedergebrannt wurden.
Schlacht.
Interessant ist die rechte Seite, wo wir zwei Schützen sehen. Der obere hat keine Panzerung, der untere hingegen schon. Vielleicht gab es spezielle Pfeile, die in einer geschlossenen Reihe verwendet wurden, oder die Antwort liegt im nächsten Bild.
Herzog Wilhelm fordert seine Soldaten auf, sich auf den Kampf mit der englischen Armee vorzubereiten.
Angriff der Normannen auf den Schildwall der Sachsen. Die Speere wurden für eine höhere Schlageffizienz über die Schulter gehalten. Diese Technik wurde oft beim Ritterturnieren eingesetzt. Es war jedoch schwer genug, die Schildbarriere zu durchbrechen, die sowohl vor Pfeilen als auch vor Speeren gut schützte. Eine solche Verteidigungstaktik hatte Wilhelm noch nie zuvor gesehen und war daher etwas verblüfft. Achten Sie auch auf die Form der Schilde – in Form eines Drachens, oder? Es ist bekannt, dass in der Schlacht auch runde Schilde verwendet wurden, und zwar auf beiden Seiten, aber soweit ich sehen kann, ist dies auf dem Wandteppich nicht dargestellt. Die Sachsen waren nicht geneigt, Bogenschützen einzusetzen, aber dennoch überzeugt uns die Position dieses Schützen hinter dem Schirm der sächsischen Schilde davon, dass er ein Unterstützer von König Harold ist. Am unteren Rand des Wandteppichs sehen wir zahlreiche Körper von Menschen und Tieren.
Pali Leofwine und Gyrth, Harolds Brüder.
Dieser Teil des Wandteppichs erzählt vom Tod von Harolds Brüdern – Jirta und Leofvin. Es sieht so aus, als wären sie nicht in der Nähe von Harold in seinem Kommandozentrale am Hang gewesen. Sie befanden sich höchstwahrscheinlich auf der rechten Flanke der sächsischen Armee und wurden in die Verfolgung der Bretonen den Hügel hinunter verwickelt, da sie glaubten, dass sich die gesamte Armee zurückzog. Es ist nicht bekannt, ob Harold selbst oder seine impulsiven Brüder diesen taktisch falschen Schritt gemacht haben, aber die Tatsache ist offensichtlich: Es war dieser Fehler, der die Niederlage der Sachsen verursachte.
Der Tod der Franzosen und Briten im Kampf.
Ein lebendiges Beispiel für die Wirksamkeit der dänischen Kriegsaxt. Diese langstieligen Äxte konnten sowohl Reiter als auch Pferd zur Strecke bringen. Es war eine finstere Waffe und wurde ursprünglich von den Dänen, insbesondere den Leibwächtern von König Knut, eingesetzt.
Bischof Odo ermutigt die Soldaten mit dem Stab in der Hand.
Herzog Wilhelm.
Für Wilhelm lief es nicht gut, als seine linke Flanke schwächer wurde. Darüber hinaus verbreiteten sich Gerüchte über seinen Tod. Um seinen Männern zu zeigen, dass er noch am Leben war, hob Wilhelm sein Visier und zeigte den Soldaten sein Gesicht. Hätte er es nicht getan, wäre die Schlacht womöglich dort zu Ende gewesen.
Eustachius. Hier kämpfen die Franzosen.
Nachdem die genehmigte vorgetäuschte Rückzugstaktik erfolgreich umgesetzt worden war, beschloss Wilhelm, die sächsische Linie zu durchbrechen. Seine Bogenschützen konnten nach dem Schießen wenig tun, da sie Zeit brauchten, um ihre Waffen nachzuladen. Da die Sachsen auf ihrer Seite keine Bogenschützen einsetzen, gab es außerdem keine Pfeile von ihrer Seite. Die Bogenschützen waren gezwungen, sich zurückzuziehen, um ihre Vorräte an Wurfwaffen mit Steinen aufzufüllen, und warteten auf weitere Anweisungen ihrer Vorgesetzten. Wilhelm beschloss, sie vorwärts loszulassen und als Schusswaffen zu verwenden, damit sie ihre Pfeile über die Schilde werfen konnten, während seine Fußsoldaten und seine Kavallerie vorankommen konnten. Der ausgelaugte Wall der Sachsen stürzte unter dieser Taktik ein und es war das Signal für das Ende der Schlacht.
Und diejenigen, die bei Harold waren, fielen. Und König Harold wurde getötet.
Harold wird dargestellt, wie er einen Pfeil in der Hand hält oder versucht, ihn aus seinem Auge zu entfernen. Selbst wenn er nicht getötet worden wäre, hätte die Tapferkeit seiner Verteidiger nicht ausgereicht, um ihn vor den Normannen zu schützen. Damit am Tod Harolds sicher kein Zweifel besteht, erledigen die Normannen ihn.
Und die Briten fliehen vom Schlachtfeld.
Dieser letzte Teil des Wandteppichs zeigt uns den Rückzug der Überreste der sächsischen Armee.
Bei der Vorbereitung des Materials wurden Informationen von Websites verwendet, die der Schlacht von Hastings gewidmet sind, darunter. aus Wikipedia.
Wandteppich im Panorama kann besichtigt werden.
Autorschaft und Technik
Der früheste schriftliche Nachweis des Teppichs findet sich im Inventar der Kathedrale von Bayeux, datiert r. Der genaue Autor dieses Kunstwerks wurde nicht identifiziert. Der traditionellen Ansicht zufolge wurde der Teppich im Auftrag von Königin Matilda, der Frau Wilhelms des Eroberers, von ihren Hofwebern bestickt. In Frankreich ist der Teppich als „Königin-Mathilden-Teppich“ bekannt.
Derzeit wird der Teppich in einem speziellen Museum in Bayeux ausgestellt. Um eine Verschlechterung dieses Kunstwerks zu vermeiden, wird er unter Glas gelegt und im Raum für eine besondere gedämpfte Beleuchtung gesorgt.
Handlung
Die auf den Teppich gestickten Bilder erzählen die Geschichte der normannischen Eroberung Englands. Die Ereignisse spielen sich in chronologischer Reihenfolge ab und werden durch aufeinanderfolgende Szenen dargestellt: die Entsendung Harolds durch König Eduard den Bekenner in die Normandie; seine Gefangennahme durch die Männer von Guy, Graf von Ponthieu, und seine Freilassung durch Herzog Wilhelm; Harolds Eid an Wilhelm und seine Teilnahme an der Belagerung von Dinan; der Tod von Eduard dem Bekenner und die Krönung Harolds; das Erscheinen eines Kometen über Harolds Palast, der Unglück ankündigt; Williams Vorbereitungen für die Invasion und die Route seiner Flotte über den Ärmelkanal; und schließlich die Schlacht von Hastings und der Tod von Harold.
Die Autoren des Teppichs spiegelten die normannische Sicht auf die Ereignisse in der Stadt wider. So wird der angelsächsische König Harold als heuchlerisch dargestellt und der normannische Herzog William als entschlossener und mutiger Krieger. Harolds Krönung wird vom exkommunizierten Stigand durchgeführt, obwohl die Salbung laut Florence von Worcester höchstwahrscheinlich von Erzbischof Eldred durchgeführt wurde, der in voller Übereinstimmung mit den Kirchenkanonen geweiht wurde.
Ein Teil des etwa 6,4 m langen Teppichs ist nicht erhalten. Es stellte wahrscheinlich Ereignisse nach der Schlacht von Hastings dar, darunter die Krönung Wilhelms des Eroberers.
Links
Wikimedia-Stiftung. 2010 .
Bayeux (fr. Bayeux) ist eine Stadt in der Normandie (Nordwestfrankreich) im Departement Calvados. Bayeux liegt im fruchtbaren Tal des Flusses Or, 12 km vom Ärmelkanal entfernt.
In der Antike war Bayeux das Zentrum des gälischen Stammes der Baiokassi, wurde in der Römerzeit „Augustodorum“ genannt und erreichte, wie die Überreste von Aquädukten, Turnhallen und anderen Zeichen der Zivilisation zeigen, einen gewissen Wohlstand.
Im 3. Jahrhundert gehörte dieses Gebiet zur sogenannten „Sächsischen Küste“ (lat. Litus Saxonicum, das moderne Departement der Antlantischen Loire), dann zum Gebiet Kleinsachsens (lat. Otlingua Saxonia, das moderne Departement Calvados). ), wo Karl der Große die von ihm eroberten Sachsen vertrieb. Die Nachkommen dieser Siedler wurden lange Zeit „Bessen-Sachsen“ genannt. Bayeux war die Hauptstadt der Region Bessin. Im 4. Jahrhundert wurde in der Stadt ein Bistum gegründet, und im 9. Jahrhundert schloss sich dem sächsischen Element ein weiteres Element, ebenfalls germanischen Ursprungs, an. Norman Rollo (seit 912 christlicher Herzog der Normandie) nahm Bayeux vom Grafen Berengarde, der bei der Erstürmung der Stadt durch die Wikinger getötet wurde und dessen schöne Tochter die Frau des Siegers wurde. So wurde Bayeux zum Hauptzentrum der normannischen Macht in der Haute-Normandie und bewahrte die skandinavischen Bräuche länger als andere Städte.
Die Hauptattraktion der Stadt ist die Kathedrale, deren Bau 1105 begann und 1497 abgeschlossen wurde. Die Stadt verfügt auch über ein Museum, das den berühmten „Bayeux-Teppich“ ausstellt, ein Denkmal frühmittelalterlicher Kunst, bei dem es sich um eine bestickte Leinwand handelt 50 cm hoch und 70,3 m lang, mit Darstellung der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Eroberung Englands durch Wilhelm von der Normandie. In Frankreich ist der Wandteppich als „Teppich der Königin Matilda“ bekannt, da man lange glaubte, dass dieses Gemälde von der Frau Wilhelms des Eroberers, Königin Matilda, gestickt wurde. Derzeit gibt es jedoch eine zweite Theorie, dass Odo, Bischof von Bayeux, einer der engsten Mitarbeiter und Halbbruder (von der Mutter) Wilhelms, der Kunde des Teppichs war, und in diesem Fall handelte es sich wahrscheinlich um englische Weber, die den Wandteppich stammten Hersteller, da der Hauptgrundbesitz des Bischofs in Kent lag. Dies wird indirekt durch die Tatsache bestätigt, dass einige der lateinischen Namen auf dem Teppich von angelsächsischen abgeleitet sind und die zur Herstellung des Teppichs verwendeten Pflanzenfarben in England weit verbreitet waren. Es besteht die Vermutung, dass es sich bei den Urhebern des Teppichs aus Bayeux um Mönche des Klosters St. Augustinus in Canterbury.
Die Haupthandlung des Wandteppichs ist die Schlacht von Hastings (dt. Schlacht von Hastings, 14. Oktober 1066) zwischen der angelsächsischen Armee von König Harold Godwinson und den Truppen des normannischen Herzogs William:
„Sie haben den größten Teil des Tages erbittert gekämpft, und keine Seite hat nachgegeben. Davon überzeugt gab Wilhelm das Signal zu einer imaginären Flucht vom Schlachtfeld. Infolge dieser List gerieten die kämpfenden Reihen der Angles in Aufruhr und versuchten, den willkürlich zurückweichenden Feind auszurotten, und ihr eigener Tod wurde dadurch beschleunigt; denn die Normannen wandten sich scharf ab, griffen den uneinigen Feind an und schlugen ihn in die Flucht. Also, von List getäuscht, akzeptierten sie einen glorreichen Tod und rächten ihr Heimatland. Dennoch rächten sie sich mit Zinsen und hinterließen, hartnäckig Widerstand leistend, Haufen von Toten von ihren Verfolgern. Nachdem sie den Hügel in Besitz genommen hatten, warfen sie die Normannen in das Becken, als diese, eingehüllt in die Flammen [der Schlacht], hartnäckig die Höhen erklommen und jeden einzelnen vernichteten, indem sie ohne Schwierigkeiten Pfeile auf die von unten herannahenden und rollenden Menschen abschossen Steine darauf.
Chronist Wilhelm Poatevinsky über die Schlacht der Normannen und Angelsachsen.
Der früheste schriftliche Nachweis des Teppichs findet sich im Inventar des Besitzes der Kathedrale von Bayeux aus dem Jahr 1476. Der Teppich wurde Ende des 17. Jahrhunderts in Bayeux entdeckt, wo er der Überlieferung nach einmal im Jahr ausgestellt wurde in der örtlichen Kathedrale. Die ersten Reproduktionen des Teppichs wurden in den 1730er Jahren veröffentlicht. Bernard de Montfaucon. Während der Französischen Revolution wollten einige Republikaner aus Bayeux aus einem Teppich einen Teppich für einen militärischen Munitionswagen machen, aber einer der Anwälte, der den Wert des Teppichs erkannte, rettete ihn, indem er einen anderen Stoff zur Verfügung stellte. Im Jahr 1803 brachte Napoleon den Teppich nach Paris, um die geplante französische Invasion in England zu fördern. Als der Invasionsplan jedoch scheiterte, wurde der Teppich nach Bayeux zurückgebracht. Dort wurde es zusammengerollt aufbewahrt, bis es von Vertretern des deutschen Ahnenerbes erbeutet wurde. Den größten Teil des Zweiten Weltkriegs verbrachte der Teppich in den Kerkern des Louvre.
Derzeit wird der Teppich in einem speziellen Museum in Bayeux ausgestellt. Um eine Verschlechterung dieses Kunstwerks zu vermeiden, wird er unter Glas gelegt und im Raum für eine besondere gedämpfte Beleuchtung gesorgt.
Der Teppich ist auf Leinen mit Wollfäden in vier Farben bestickt: Violett, Blau, Grün und Schwarz. Beim Sticken kamen die Kettenstichtechnik, die Stielstichtechnik sowie ein einfaches „Set“ zum Einsatz.
Die Ereignisse spielen sich in chronologischer Reihenfolge ab und werden durch aufeinanderfolgende Szenen dargestellt: die Entsendung Harolds durch König Eduard den Bekenner in die Normandie; seine Gefangennahme durch das Volk von Guy, Graf von Ponthieu, und seine Freilassung durch Herzog Wilhelm; Harolds Eid an Wilhelm und seine Teilnahme an der Belagerung von Dinan; der Tod von Eduard dem Bekenner und die Krönung Harolds; das Erscheinen eines Kometen über Harolds Palast, der Unglück ankündigt; Williams Vorbereitungen für die Invasion und die Route seiner Flotte über den Ärmelkanal; und schließlich die Schlacht von Hastings und der Tod von Harold. Ein Teil des etwa 6,4 m langen Teppichs ist nicht erhalten. Es stellte wahrscheinlich Ereignisse nach der Schlacht von Hastings dar, darunter die Krönung Wilhelms des Eroberers.
Die Autoren des Teppichs spiegelten den normannischen Standpunkt zu den Ereignissen von 1066 wider, zum Beispiel wurde die Krönung Harolds vom exkommunizierten Stigand durchgeführt, obwohl die Salbung laut Florence von Worcester höchstwahrscheinlich von Erzbischof Eldred durchgeführt wurde , der in voller Übereinstimmung mit den Kirchenkanonen ordiniert wurde. Darüber hinaus traf der Legende auf dem Teppich von Bayeux zufolge ein Pfeil das rechte Auge des Königs. Einer anderen Version zufolge wurde Harold von normannischen Rittern zu Tode gehackt. Die Chronik von Roman de Rou berichtet, dass König Harold von einem Pfeil ins Auge getroffen wurde, den Pfeil jedoch herauszog und weiter kämpfte, bis er unter den Schlägen der normannischen Ritter fiel. Noch früher starben die Brüder des Königs, Girth und Leofvin. Ohne Anführer floh die angelsächsische Armee, obwohl die Truppe des Königs bis zuletzt weiter um die Leiche ihres Oberherrn kämpfte.
Williams Sieg war vollständig. Mehrere tausend Angelsachsen blieben auf dem Schlachtfeld liegen. Der zerstückelte Körper von König Harold Wilhelm übergab ihn später seiner Mutter zur Beerdigung.
Gedenktafel am Todesort von König Harold: 
Die Schlacht von Hastings ist eine der wenigen Schlachten, die den Lauf der Geschichte drastisch verändert hat. Der Sieg öffnete England für William. Nach kurzem Widerstand gab London nach und die überlebende angelsächsische Aristokratie erkannte Wilhelms Rechte auf den englischen Thron an.
Am 25. Dezember 1066 wurde Wilhelm in der Westminster Abbey zum König von England gekrönt. Infolge der normannischen Eroberung wurde der alte angelsächsische Staat zerstört und durch eine zentralisierte feudale Monarchie mit starker königlicher Macht ersetzt, die auf der europäischen Ritterkultur und einem Vasallen-Lehen-System beruhte. Die Entwicklung des Landes erhielt neue Impulse, die es England ermöglichten, in kurzer Zeit zu einer der stärksten Mächte Europas aufzusteigen.
An der Stelle der Schlacht von Hastings wurde das Battle Monastery gegründet (engl. Battle – „Schlacht“), und der Altar der Hauptkirche des Klosters befand sich direkt an der Stelle des Todes von König Harold. Später entstand rund um das Kloster die kleine Stadt Battle.
Das Schlachtfeld von Hastings. Blick von den normannischen Stellungen: 
Am Morgen gingen wir zu dem Ort, den ich unbedingt sehen wollte, von dem ich aber fast nichts wusste – das Teppichmuseum in der Kleinstadt Bayeux.
Eine kleine Geschichte der Stadt. Bayeux erschien im 1. Jahrhundert v. Chr. als römisches Lager zum Schutz vor Angriffen der Germanen. Chr. unter dem Namen Augustodurum. Obwohl es bereits früher Befestigungsanlagen zwischen dem Meer und dem Fluss Or gab, wurden keine Hinweise auf die Existenz einer keltischen Stadt gefunden. In der galloromanischen Zeit war es ein wichtiges Zentrum an der Straße zwischen dem heutigen Lisieux und Valogne, an der Furt über den Or, die die Stadt von Süden nach Norden durchquert. Da sich die Siedlung im 4. Jahrhundert auf dem Territorium des gallischen Stammes der Bayokasser (wie Plinius sie nannte) befand. es wird bereits als Baiocassium bezeichnet.
Am Westufer des Flusses entstand zunächst eine Siedlung von Handwerkern und Kaufleuten. In der Nähe befand sich der Berg Faunus, wo bereits die keltischen Druiden ihre Rituale durchführten. Dieser Berg wurde auch mit den ersten Märtyrern der neuen Religion – dem Christentum – in Verbindung gebracht. All dies trug offenbar zur weiteren Umwandlung der Siedlung in ein religiöses Zentrum bei. Am Ende des Römischen Reiches wurde es zu einem der ältesten bischöflichen Zentren.
Die Stadt der Römerzeit hatte einen klaren rechteckigen Grundriss, der auch in der mittelalterlichen Stadt erhalten blieb, der lange Zeit nicht über die Mauern hinausging: Im Norden lebten Handwerker, im Südwesten Adlige und im Südwesten kirchliche Besitztümer Süd-Ost. Darüber hinaus wird der Kirchenbesitz immer wichtiger und umfangreicher, und die einst existierende normannische Burg verschwindet vollständig (der heutige De-Gaulle-Platz).
Das Bistum Bayeux ist eines der ältesten in der Normandie. Die ersten Bischöfe stammten aus dem galloromanischen Adel, der den Königen nahe stand. Nach dem Untergang des Römischen Reiches nahm die bischöfliche Macht zu. Nach der Gründung im 10. Jahrhundert. Die Bischöfe des Herzogtums stammten aus der normannischen Herzogsfamilie. Unter Wilhelm dem Eroberer blühte die religiöse Macht in der Stadt auf. Nicht weit von Bayeux entfernt lag Caen, das zur Zeit Wilhelms die Hauptstadt des Herzogtums war. Der Herzog ernennt seinen Halbbruder Odon zum Bischof. Unter ihm begann der Bau der heutigen Kathedrale. Und es ist Odon, der seit Jahrhunderten den berühmten Teppich in dieser Kathedrale platziert.
Während des Thronkrieges zwischen den Söhnen Wilhelms erlitt Bayeux große Zerstörungen und einen Niedergang. Im 13. Jahrhundert. Als Teil der Normandie untersteht er dem französischen König. Doch die religiöse Macht der Geistlichen ist in der Stadt nach wie vor sehr stark, denn da sie über enormen Reichtum verfügten, konnten sie sich Vorteile vom König erkaufen. Erst nach dem Hundertjährigen Krieg entstand in der Stadt eine starke weltliche Macht, die sich der religiösen widersetzte. Religionskriege schwächten die Kirche, spalteten die Einwohner und bremsten so erneut die Entwicklung der Stadt. Die bischöfliche Macht nahm im 17. Jahrhundert zu, als die Stadt über die Stadtmauer hinausging, die etwa entlang der Grenze des noch römischen Lagers verlief. Um das Zentrum herum befinden sich zahlreiche Klöster verschiedener Orden. Die Revolution beendete die religiöse Macht in der Stadt.
Bayeux liegt 12 km von den Stränden entfernt, an denen die Alliierten im Juni 1944 landeten. Während der Operation Overlord wurde die Stadt als erste befreit und konnte so einer Zerstörung entgehen. Hier siedelte sich die erste französische Regierung im befreiten Gebiet an. Um die Operation zur Befreiung von Kan vorzubereiten, bauten die Alliierten sogar eine Umgehungsstraße (heute Bezirksboulevard), damit die Vibrationen schwerer Geräte die antike Stadt und ihre Kathedrale nicht zerstören würden. An der Ringstraße gibt es derzeit einen Friedhof für die bei der Befreiung der Normandie gefallenen Alliierten und ein diesem gewidmetes Museum.
Da Bayeux lange Zeit das bischöfliche Zentrum war, ist es notwendig, über die Hauptkathedrale der Stadt zu sprechen. Kathedrale Unserer Lieben Frau von Bayeux Sie wurde vom 11. bis zum 15. Jahrhundert erbaut und war vom 4. bis zum 19. Jahrhundert die Hauptkathedrale des Bistums, das hier existierte. Bischof Hugo von Evry begann mit dem Bau, doch die Kathedrale wurde unter Odon fertiggestellt und geweiht. Odon beteiligte sich an der Eroberung Englands, erhielt erhebliche finanzielle Mittel und konnte den Bau danach schnell abschließen. Der Tempel wurde im Beisein von Wilhelm und Mathilde geweiht. Aber dieser wurde bereits genutzt, denn auf dem Teppich von Königin Matilda leistet Harold einen Treueeid auf die Reliquien dieser Kathedrale.
Kathedrale Unserer Lieben Frau von Bayeux
Rund um die Kathedrale bildete sich ein Viertel des Klerus: die Häuser des Klerus (XIV.-XVIII. Jahrhundert), der Bischofspalast, die Bibliothek des Kapitels, das Haus des Kanonikers.
Die ältesten Teile der Kathedrale sind die Krypta (mit dekorativen Elementen aus dem 11. Jahrhundert und Wandgemälden aus dem 15. Jahrhundert) und die Fundamente der Türme der Westfassade. Nur die Krypta blieb nach dem Erbfolgekrieg der Söhne Wilhelms des Eroberers erhalten, als die Kathedrale fast vollständig ausbrannte. Dann brannte die Kathedrale Ende des 12. Jahrhunderts erneut. Fast anderthalb Jahrhunderte lang war die Krypta zugemauert. Als man sich zum Wiederaufbau der Kathedrale entschloss, war der romanische Stil bereits der Gotik gewichen. Deshalb begannen sie, es in einem neuen Stil umzubauen. Damit war die Kathedrale eines der ersten Bauwerke dieses Stils. Dies war vielleicht das erste Beispiel für den Bau eines hohen Mittelschiffs in der Architektur, das eine bessere Beleuchtung des Tempels ermöglichte.

Krypta der Kathedrale
Von außen ist die Kathedrale ein Gebäude, das fast vollständig dem 13. Jahrhundert zugeschrieben werden kann. Die romanischen Türme wurden mit gotischen Spitzbogenspitzen angebaut.

Westportal der Kathedrale außen
Die Westfassade hat drei Portale. Die Skulpturen gingen während der Religionskriege verloren. Das Tympanon des linken Portals ist den Leidenschaften Christi gewidmet, das rechte dem Jüngsten Gericht. Während des Hundertjährigen Krieges diente der Nordturm als Wachposten.

Westportal der Kathedrale von innen; Glasmalerei aus dem 13. Jahrhundert
Am ungewöhnlichsten ist die Südfassade. Das Tympanon des Kanonikerportals zeigt Szenen aus dem Leben des englischen Heiligen Thomas Becket. Dieser Heilige war im 13. Jahrhundert in Frankreich beliebt. Beschreibungen seines Lebens wurden übersetzt und gelesen. Er besuchte Bayeux während seines Exils aus England. So landeten Szenen aus seinem Leben in einer französischen Kathedrale. Es gibt auch eine Skulptur, die nicht von Vandalen zerstört wurde. An der Wand sind Inschriften angebracht, die der verstorbenen Schwester eines der Bischöfe gewidmet sind.
Das Nordportal existierte vorher nicht. Es wurde erst im 19. Jahrhundert gebrochen. Auf dieser Seite schließt sich an den Dom die Kapitelbibliothek an, in der Dokumente und Bücher kopiert und aufbewahrt wurden. Von derselben Seite ist die Rückseite der Türme des Westportals deutlich zu erkennen.
Mit dem Bau des hohen Mittelturms, der für Gebäude im normannischen Stil charakteristisch ist, wurde erst im 14. Jahrhundert begonnen. Es wurde lange gebaut, durch Brände zerstört, durch „Restaurierungen“ verändert und erst im 19. Jahrhundert bereits im neugotischen Stil fertiggestellt.
Im Inneren der Kathedrale sind mehrere interessante Orte erhalten geblieben. Der untere Teil der Kathedrale ist romanisch. Das Dekor enthält Elemente des normannischen Stils. Im südlichen Teil sieht man auf den Flachreliefs unter anderem das sogenannte Liebespaar von Bayeux und eine Wiederholung von Harolds Schwur vom Teppich. Die ersten Bischöfe sind in Medaillons an der Decke des Chores dargestellt.

Liebhaber aus Bayeux
An der Wand in der Nähe des Südportals (kanonisch) befinden sich die Verkündigung, die Dreifaltigkeit, die Kreuzigung und Szenen aus dem Leben des Heiligen Nikolaus – alle aus dem 13. Jahrhundert, das Martyrium des Heiligen Thomas Becket (19. Jahrhundert).

Dreifaltigkeit – oben und die Verkündigung – unten (XIII. Jahrhundert)

Aus dem Leben des Heiligen Nikolaus (XIII. Jahrhundert) – unten, Die Ermordung von Thomas Becket (XIX. Jahrhundert) – oben
In der Nähe der Nordwand befindet sich eine Schatzkammer (Eingang nur mit einer Gruppe), in der jahrhundertelang ein Teppich aufbewahrt wurde, und jetzt gibt es Gegenstände aus dem 12.-13. Jahrhundert (die Riza von St. Renobert, eine Schatulle mit arabischen Arbeiten, u Schrank mit mittelalterlichen Gemälden). Neben dem Eingang befindet sich ein Buntglasfenster aus dem 13. Jahrhundert (ein weiteres befindet sich am Westportal, wo sich die Orgel befindet). Hinter dem Nordturm befindet sich ein Durchgang zum Kapitelsaal (nur mit Gruppe), wo das Labyrinth erhalten geblieben ist. Die Kapellen dieser Seite sind mit der Bibliothek, dem Bischofspalast, verbunden.

Wenn Sie die Kathedrale durch das Westportal verlassen, biegen Sie links ab und gehen Sie die Straße entlang der Südfassade entlang und überqueren Sie weiter das Or, dann gelangen Sie zu dem Gebäude, das sich im ehemaligen Priesterseminar befindet Zentrum von Wilhelm dem Eroberer. Dort befindet sich heute der Teppich von Bayeux oder der Teppich der Königin Mathilde. Überall in der Stadt sind Schilder zum Teppichmuseum angebracht. Das Museum erstreckt sich über 2 Etagen. Das obere ist die Geschichte der Entstehung des Teppichs und unten, im Halbdunkel, unter dem Glas, ist dieses Wunder, das unten beschrieben wird. Am Eingang werden Audioguides in 14 Sprachen ausgegeben, inkl. auf Russisch. Der Rundgang entlang des Teppichs dauert ca. 1 Stunde. Die maximalen Kosten für einen Besuch betragen derzeit 9 Euro, für Studenten und Schüler über 10 Jahre 4 Euro.

Fluss Or
Manche nennen dieses Objekt einen „Teppich“, manche einen „Wandteppich“, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine Stickerei. Einige Details passen nicht in meinen Kopf: Wie konnte dieser Wandteppich fast 1000 Jahre lang erhalten bleiben, wie viele Menschen haben ihn bestickt (und seine Länge ist erstaunlich), warum erschien dieses Wunder erst 2007 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes ?
Der Teppich (wir werden ihn so nennen, weil er Tapisserie genannt wird) wurde unmittelbar nach der Schlacht von Hastings bestickt. Es gibt zwei angebliche Kunden (da solche Arbeiten stets auf Bestellung ausgeführt wurden): Herzogin-Königin Matilda, Ehefrau von Wilhelm dem Eroberer, und Bischof Odon, sein Halbbruder. Die zweite Version erscheint vielen aus vielen Gründen realistischer. Bischof Odon selbst war Teilnehmer der Schlacht von Hastings. Nach der Eroberung nahm er die Ländereien in Kent in Besitz und der seit langem erforschte Stickstil ist der südöstliche angelsächsische Stil. Der Teppich zeigt drei ungefähre Bischöfe. Er stand lange Zeit an der Spitze des Bistums Bayeux (von 1049 bis 1097) und begann auf seinen Befehl hin mit dem Bau der Liebfrauenkathedrale. Der Teppich zeigt eine Schwurszene auf Reliquien aus der Kathedrale von Bayeux. Der Teppich wurde viele Jahrhunderte lang in der Liebfrauenkathedrale dieser Stadt aufbewahrt, von wo er einmal im Jahr im Juli anlässlich des Reliquienfestes „zur öffentlichen Besichtigung“ herausgeholt wurde (d. h. es handelte sich um eine Geschichte in Bildern). die Eroberung Englands durch Wilhelm für ungebildete Gemeindemitglieder).

Bischof Odon nimmt an der Schlacht von Hastings teil
Jetzt werde ich die Zahlen zum Thema Stickerei nennen. Der Teppich ist auf Leinen gestickt, es werden Fäden in 8 Farben verwendet. Breite – ca. 50 cm, Länge – ca. 70 m. Der Teppich umfasst 58 Szenen. Es wird angenommen, dass seit fast 1000 Jahren zwei Szenen verloren gegangen sind (vielleicht Williams Einzug in London, seine Krönung in Westminster, der Bau des Towers). Der Teppich stellt detailliert die Ereignisse von 1064 bis 1066 dar. Mehr als 600 Menschen, 200 Pferde, 50 Hunde, 30 Gebäude, 40 Schiffe wurden bestickt, die Gesamtzahl der Motive beträgt mehr als 1500. Nach dem Studium der Stickerei kamen wir zu dem Schluss, dass der Teppich von zwei (!) Stickern angefertigt wurde in 2 Jahren. Oben sind die gestickten Ereignisse in lateinischer Sprache zusammengefasst. Die Stickerei zeigt Werkzeuge, Frisuren, Kleidung des 11. Jahrhunderts, reale Ereignisse (das Erscheinen des Halleyschen Kometen), Fabelwesen aus den damals bekannten Geschichten (Fabeln, antike Mythen). Zeitgenossen (Guillaume aus Poitiers und Guillaume aus Jumièges) berichteten über die auf dem Teppich dargestellten historischen Ereignisse, ein Jahrhundert später wurden sie durch zwei weitere Autoren ergänzt, nämlich Stickereien sind dokumentiert.

Der Halleysche Komet wurde während der Krönung Harolds gesehen
Von wem und wo auch immer der Teppich bestickt wurde, er wurde angefertigt, um die Legitimität von Wilhelms Eroberung Englands zu beweisen. Es ist eine Geschichte über den Triumph des Guten über das Böse, denn Harold schwor zunächst William als seinem Oberherrn die Treue und brach diese dann, wofür er bestraft wurde und in der Schlacht von Hastings starb.
Ein paar Worte zu den Figuren auf dem Teppich und den Ereignissen, die vor denen stattfanden, die darauf gestickt waren. Ich habe im vorherigen Teil über Wilhelm gesprochen. Edward der Bekenner war der Sohn einer der normannischen Herzoginnen (seine Mutter Emma war die Schwester von Williams Großvater). Nach der Ermordung ihres ersten angelsächsischen Mannes heiratete sie dessen Mörder, den Dänen Knut. Danach versteckte sich Edward viele Jahre lang bei Verwandten in der Normandie. Harold war der Schwager des englischen Königs Eduard dem Bekenner (er war mit dessen Schwester verheiratet), einem Nachkommen einer wohlhabenden angelsächsischen Familie in Wessex. Somit war Wilhelm der Erbe des Blutes des englischen Königs. Harold wurde vom angelsächsischen Adel unterstützt, der ihn nach Edwards Tod zum König wählte.

Eduard der Bekenner
Die Geschichte beginnt im Jahr 1064, als Harald zu Wilhelm geht, um ihm den Wunsch Eduards des Bekenners mitzuteilen, ihn zum Erben des englischen Throns zu machen. Es gibt eine Version, dass er in die Normandie ging, um seinen als Geisel genommenen Bruder freizukaufen. Während eines Sturms geht er nicht dorthin, wo er geplant hatte. Er wird gefangen genommen. Wilhelm erlöst Harold aus der Gefangenschaft. Er lebt in der Normandie und nimmt an Williams Feldzügen in der Bretagne teil. Dann folgt die Szene des Vasallenschwurs auf den Reliquien der Kathedrale von Bayeux.

Harold leistet einen Eid auf die Reliquien der Liebfrauenkathedrale
Dann kehrt Harold nach England zurück. Zwei Jahre später stirbt der kinderlose Edward. Harold wird gekrönt. Wilhelm wird auf die Ereignisse in England aufmerksam. Er rüstet die Flotte aus und segelt nach England, um sein Erbe entgegenzunehmen. Da Meineid damals eine schwere Sünde war und vom Papst unterstützt wird, treten viele europäische Söldner in die Armee ein.

Während der Schlacht von Hastings soll William getötet worden sein. Er öffnet sein Visier, um zu zeigen, dass er lebt
Was folgt, ist die Geschichte der Schlacht von Hastings, in der Harold getötet wird. Lange Zeit glaubte man, er sei durch einen Pfeil im rechten Auge gestorben. Aber es gibt eine Version, dass sein Bruder durch einen Pfeil starb und Harold mit einem Schwert getötet wurde. All dies wird wie in einem Comic auf dem Teppich erzählt. Und dieser Comic kann endlos angeschaut werden – es stört nicht.

Harold wird von einem Pfeil getötet
Die erste schriftliche Erwähnung des Teppichs stammt aus dem 15. Jahrhundert. Während der Religionskriege wurde es versteckt. Erst im 17. Jahrhundert interessierten sich Wissenschaftler für den Teppich. Bis zum 18. Jahrhundert wurde es in der Schatzkammer der Liebfrauenkathedrale in Bayeux aufbewahrt. Während der Revolution, als die Kirchen geschlossen wurden, wurde der Teppich fast in Stücke geschnitten, um die exportierten Wertgegenstände zu verpacken. Glücklicherweise intervenierte der Anwalt von Lambert-Leforestier. Dann brachte Napoleon den Teppich nach Paris, wo er zum Werbemittel für seine Idee einer zweiten Eroberung der britischen Inseln wurde. Anschließend wurde der Teppich im Louvre der Öffentlichkeit ausgestellt. Als die Eroberung scheiterte, wurde der Teppich zurückgegeben. Im 19. Jahrhundert Sie machen eine Kopie davon für England. Während des Zweiten Weltkriegs befindet sich der Teppich in einem der Schlösser, wo er von deutschen Wissenschaftlern untersucht wird. Dann wird er in den Louvre zu einer Ausstellung primitiver Kunst gebracht, von wo aus sie nach Deutschland gebracht werden sollen, aber sie haben keine Zeit. Der Teppich kehrt 1945 nach Bayeux zurück, wo er bis heute verbleibt.
In der Stadt können Sie auch das Kunstmuseum von Baron Gerard besichtigen (in einem Teil des ehemaligen Bischofspalastes, im Rest befindet sich das Rathaus); neben dem Platz Der Freiheitsbaum lässt die Freiheit wachsen, die während der Revolution gepflanzt wurde. ein britischer Militärfriedhof, ein Museumsdenkmal für die Schlacht um die Normandie und ein Denkmal für die seit 1944 verstorbenen Journalisten (auf dem Bezirksboulevard). Die ältesten Kirchen sind den ersten Bischöfen gewidmet: St. Exupery (im Osten der Stadt wurden hier Bischöfe begraben), St. Vigor, St. Patrick. In der Stadt sind Fachwerkhäuser aus dem 14.-16. Jahrhundert und Herrenhäuser aus dem 17.-19. Jahrhundert erhalten geblieben.

Freiheitsbaum
In Bayeux entwickelte sich die Kunst der Klöppelspitze und der Porzellanherstellung.
Jedes Jahr am ersten Wochenende im Juli findet in der Stadt ein Mittelalterfest statt.
Unter den zahlreichen historischen Denkmälern der Antike ist dieses eines der berühmtesten und „sprechendsten“, da es Inschriften trägt. Allerdings ist er auch einer der geheimnisvollsten. Wir sprechen über den weltberühmten „Bayeux-Wandteppich“, und es ist bereits passiert, dass ich hier, auf den Seiten von VO, lange Zeit nicht darüber sprechen konnte. Ich hatte keine Originalmaterialien zu diesem Thema und beschloss daher, einen Artikel in der ukrainischen Zeitschrift Science and Technology zu verwenden, die jetzt auch im Einzelhandel und im Abonnement in Russland vertrieben wird. Dies ist bis heute die ausführlichste Studie zu diesem Thema, die auf der Untersuchung vieler ausländischer Quellen basiert.
„Hier ist er, William!“ - der dramatische Moment der Schlacht, als sich unter den Kämpfern das Gerücht verbreitete, ihr Anführer sei getötet worden.
Zum ersten Mal erfuhr ich von dem „Wandteppich“ aus der „Kinderenzyklopädie“ der Sowjetzeit, in der er aus irgendeinem Grund ... „Bayonne-Teppich“ genannt wurde. Später erfuhr ich, dass in Bayonne Schinken hergestellt wird, aber die Stadt Bayeux ist der Aufbewahrungsort dieses legendären Wandteppichs, weshalb er auch so genannt wurde. Mit der Zeit wurde mein Interesse am „Teppich“ immer stärker, ich schaffte es, viele interessante (und hier in Russland unbekannte) Informationen darüber zu bekommen, aber am Ende ist genau dieser Artikel daraus entstanden ...

Lage der Stadt Bayeux in Frankreich.
Es gibt nicht so viele Schlachten auf der Welt, die das ganze Land radikal verändert haben. Tatsächlich gibt es im westlichen Teil der Welt wahrscheinlich nur eine davon – die Schlacht von Hastings. Aber woher wissen wir davon? Welche Beweise gibt es überhaupt dafür, dass es das wirklich war, dass es keine Erfindung müßiger Chronisten und kein Mythos war? Eines der wertvollsten Zeugnisse ist der berühmte „Bayes-Teppich“, auf dem „die Hände von Königin Matilda und ihren Hofdamen“ – so wird es in unseren heimischen Geschichtsbüchern üblicherweise geschrieben – die normannische Eroberung darstellt England und die Schlacht von Hastings selbst. Doch das gefeierte Meisterwerk wirft ebenso viele Fragen auf, wie es beantwortet.

Willkommen in Bayeux! - ein Schild auf dem Bahnsteig des örtlichen Bahnhofs.
Werke von Monarchen und Mönchen
Die frühesten Informationen über die Schlacht von Hastings stammen keineswegs von den Engländern, aber auch nicht von den Normannen. Sie wurden in einem anderen Teil Nordfrankreichs aufgezeichnet. Damals war das moderne Frankreich ein Flickenteppich verschiedener herrschaftlicher Besitztümer. Die Macht des Königs war nur in seinem Herrschaftsbereich stark, für den Rest der Länder war er nur ein nomineller Herrscher. Auch die Normandie genoss große Unabhängigkeit. Es wurde im Jahr 911 gegründet, nachdem König Karl der Einfältige (oder Rustikale, was richtiger und vor allem würdevoller klingt) das Land in der Nähe von Rouen an den Wikingerführer Rollo (bzw Rollo). Herzog Wilhelm war Rollons Ururenkel.
Bis 1066 hatten die Normannen ihre Macht von der Halbinsel Cherbourg bis zur Mündung der Somme ausgedehnt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Normannen echte Franzosen – sie sprachen Französisch und hielten an französischen Traditionen und Religion fest. Aber sie behielten das Gefühl ihrer Isolation und erinnerten sich an ihre Herkunft. Die französischen Nachbarn der Normannen ihrerseits hatten Angst vor der Stärkung dieses Herzogtums und mischten sich nicht mit den nördlichen Neuankömmlingen zusammen. Nun ja, dafür hatten sie keine passende Beziehung, das ist alles! Nördlich und östlich der Normandie lagen die Ländereien solcher „Nichtnormannen“ wie der Besitz des Grafen Guy von Poitou und seines Verwandten Graf Eustachius II. von Bologna. In den 1050er Jahren Sie waren beide mit der Normandie verfeindet und unterstützten Herzog Wilhelm bei seiner Invasion im Jahr 1066 nur, weil sie ihre eigenen Ziele verfolgten. Daher ist es besonders bemerkenswert, dass die früheste Aufzeichnung von Informationen über die Schlacht von Hastings vom französischen (und nicht vom normannischen!) Bischof Guy von Amiens, Onkel des Grafen Guy von Poitou und Cousin des Grafen Eustace von Bologna, erstellt wurde.
Das Werk von Bischof Gaius ist ein ausführliches Gedicht in lateinischer Sprache und trägt den Titel „Das Lied von der Schlacht von Hastings“. Obwohl seine Existenz schon lange bekannt war, wurde es erst 1826 entdeckt, als die Archivare des Königs von Hannover zufällig auf zwei Exemplare des Liedes aus dem 12. Jahrhundert stießen. in der Royal Library of Bristol. Das „Lied“ kann auf das Jahr 1067 datiert werden, spätestens jedoch auf die Zeit bis 1074-1075, als Bischof Guy starb. Es präsentiert einen französischen und nicht einen normannischen Standpunkt zu den Ereignissen von 1066. Darüber hinaus macht der Autor des „Liedes“ im Gegensatz zu den normannischen Quellen den Helden der Schlacht von Hastings keineswegs zu Wilhelm dem Eroberer (den er nannte). richtiger wäre es noch, Guillaume zu nennen), sondern Graf Eustachius II. von Bologna.

Eines der Häuser auf der Straße in Bayeux. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein!
Dann schrieb der englische Mönch Edmer von der Abtei von Canterbury zwischen 1095 und 1123 eine „Geschichte der jüngsten (jüngsten) Ereignisse in England“. Und es stellte sich heraus, dass seine Charakterisierung der normannischen Eroberung völlig im Widerspruch zur normannischen Version dieses Ereignisses stand, obwohl sie von Historikern, die sich für andere Quellen interessierten, unterschätzt wurde. Im 12. Jahrhundert. Es gab Autoren, die die Tradition Edmers fortsetzten und ihr Mitgefühl für die eroberten Briten zum Ausdruck brachten, obwohl sie den Sieg der Normannen rechtfertigten, der zum Wachstum spiritueller Werte im Land führte. Zu diesen Autoren zählen Engländer wie John Warchertersky, Wilhelm von Molmesbersky und Normans: Oderic Vitalis in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. und in der zweiten Hälfte der in Jersey geborene Dichter Weiss.
Ein Damm an einem Fluss, der durch die Stadt fließt.
In schriftlichen Quellen von normannischer Seite wird Herzog Wilhelm deutlich stärker beachtet. Eine solche Quelle ist die in den 1070er Jahren verfasste Biographie Wilhelms des Eroberers. einer seiner Priester, Wilhelm von Poiters. Sein Werk „The Acts of Duke William“ ist in einer unvollständigen, im 16. Jahrhundert gedruckten Fassung erhalten geblieben, und das einzige bekannte Manuskript brannte bei einem Brand im Jahr 1731 nieder. Dies ist die detaillierteste Beschreibung der Ereignisse, die für uns, den Autor, von Interesse sind davon war gut über sie informiert. Und in dieser Eigenschaft ist „The Acts of Duke William“ von unschätzbarem Wert, aber nicht ohne Voreingenommenheit. Wilhelm von Poiters ist ein Patriot der Normandie. Bei jeder Gelegenheit lobt er seinen Herzog und verflucht den bösen Usurpator Harold. Der Zweck der Arbeit besteht darin, die normannische Invasion nach ihrer Fertigstellung zu rechtfertigen. Zweifellos hat er die Wahrheit beschönigt und manchmal sogar einfach absichtlich gelogen, um diese Eroberung fair und legitim zu machen.

Die Wassermühle funktioniert noch!
Ein anderer Normanne, Oderic Vitalis, verfasste ebenfalls einen detaillierten und interessanten Bericht über die normannische Eroberung. Gleichzeitig basierte es auf denen, die im 12. Jahrhundert geschrieben wurden. Werke verschiedener Autoren. Oderic selbst wurde 1075 in der Nähe von Schrewsberg als Sohn einer englischen und normannischen Familie geboren und im Alter von 10 Jahren von seinen Eltern in ein normannisches Kloster geschickt. Hier verbrachte er sein ganzes Leben als Mönch, beschäftigte sich mit Forschung und literarischem Schaffen, und zwar zwischen 1115 und 1141. schuf eine Geschichte der Normannen, bekannt als „Kirchengeschichte“. Ein perfekt erhaltenes Autorenexemplar dieses Werkes befindet sich in der Nationalbibliothek in Paris. Hin- und hergerissen zwischen England, wo er seine Kindheit verbrachte, und der Normandie, wo er sein gesamtes Erwachsenenleben verbrachte, verschließt Auderic, obwohl er die Eroberung von 1066 rechtfertigt, die zu einer religiösen Reform führte, kein Auge vor der Grausamkeit der Neuankömmlinge. In seinem Werk zwingt er Wilhelm den Eroberer sogar dazu, sich selbst einen „grausamen Mörder“ zu nennen, und legt ihm auf seinem Sterbebett im Jahr 1087 ein für ihn völlig untypisches Geständnis in den Mund: „Ich habe die Einheimischen mit ungerechtfertigter Grausamkeit behandelt und die Reichen gedemütigt.“ und die Armen, die ihnen zu Unrecht ihr eigenes Land entzogen; Ich habe den Tod vieler Tausender durch Hungersnot und Krieg verursacht, insbesondere in Yorkshire.

Blick auf die Türme der Kathedrale Notre Dame in Bayeux.
Diese schriftlichen Quellen bilden die Grundlage für die historische Forschung. In ihnen sehen wir eine spannende, lehrreiche und geheimnisvolle Geschichte. Aber wenn wir diese Bücher schließen und uns dem Teppich von Bayeux nähern, finden wir uns wie aus einer dunklen Höhle in einer Welt voller Licht und voller leuchtender Farben wieder. Die Figuren auf dem Wandteppich sind nicht nur lustige, auf Leinen gestickte Figuren des 11. Jahrhunderts. Sie erscheinen uns wie echte Menschen, obwohl sie manchmal auf seltsame, fast groteske Weise bestickt sind. Doch schon beim bloßen Betrachten des „Wandteppichs“ beginnt man nach einiger Zeit zu begreifen, dass er, dieser Wandteppich, mehr verbirgt, als er zeigt, und dass er auch heute noch voller Geheimnisse steckt, die noch auf ihren Forscher warten.

Kathedrale Notre Dame von einer der Straßen aus.
Reise durch Zeit und Raum
Wie konnte es passieren, dass ein fragiles Kunstwerk weitaus haltbarere Dinge überlebte und bis heute überlebte? Dies ist an sich schon ein herausragendes Ereignis, das zumindest eine eigene Geschichte, wenn nicht sogar eine eigene historische Studie verdient. Die ersten Beweise für die Existenz des Wandteppichs stammen aus der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Zwischen 1099 und 1102. Der französische Dichter Baudry, Abt des Klosters Burzhel, verfasste ein Gedicht für Gräfin Adele von Bloy, Tochter von Wilhelm dem Eroberer. Das Gedicht beschreibt ausführlich den prächtigen Wandteppich in ihrem Schlafzimmer. Laut Baudry ist der Wandteppich mit Gold, Silber und Seide bestickt und zeigt die Eroberung Englands durch ihren Vater. Der Dichter beschreibt den Wandteppich detailliert, Szene für Szene. Aber es konnte nicht der Teppich von Bayeux sein. Der von Baudry beschriebene Wandteppich ist viel kleiner, auf andere Weise hergestellt und mit teureren Fäden bestickt. Vielleicht ist dieser Adele-Wandteppich eine Miniaturkopie des Bayeux-Wandteppichs, und er schmückte tatsächlich das Schlafzimmer der Gräfin, ging dann aber verloren. Die meisten Gelehrten glauben jedoch, dass der Adélie-Wandteppich nichts anderes als ein imaginäres Modell des Bayeux-Wandteppichs ist, den der Autor irgendwo in der Zeit vor 1102 gesehen hat. Als Beweis zitieren sie seine Worte:
„Auf dieser Leinwand sind Schiffe, ein Anführer, die Namen von Anführern, falls es ihn jemals gegeben hat. Wenn man an seine Existenz glauben könnte, würde man darin die Wahrheit der Geschichte erkennen.“
Die Spiegelung des Teppichs von Bayeux im Spiegel der Fantasie des Dichters ist die einzige Erwähnung seiner Existenz in schriftlichen Quellen bis zum 15. Jahrhundert. Die erste sichere Erwähnung des Wandteppichs aus Bayeux stammt aus dem Jahr 1476. Sein genauer Standort stammt aus derselben Zeit. Ein Inventar der Bayes-Kathedrale aus dem Jahr 1476 enthält Angaben, wonach die Kathedrale „ein sehr langes und schmales Leinentuch besaß, auf das Figuren und Kommentare zu den Szenen der normannischen Eroberung gestickt sind“. Aus Dokumenten geht hervor, dass die Stickerei jeden Sommer während religiöser Feiertage mehrere Tage lang rund um das Kirchenschiff der Kathedrale aufgehängt wurde.

Blick auf die Kathedrale in der Abenddämmerung.
Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, wie dieses fragile Meisterwerk aus den 1070er Jahren entstanden ist. ist im Laufe der Jahrhunderte zu uns gekommen. Für einen langen Zeitraum nach 1476 liegen keine Informationen über den Wandteppich vor. Er konnte im Feuer der Religionskriege des 16. Jahrhunderts leicht untergehen, da 1562 die Bayes-Kathedrale von den Hugenotten verwüstet wurde. Sie zerstörten Bücher in der Kathedrale und viele andere Gegenstände, die im Inventar von 1476 genannt wurden. Darunter befindet sich ein Geschenk von Wilhelm dem Eroberer – eine vergoldete Krone und mindestens ein sehr wertvoller, unbenannter Wandteppich. Die Mönche wussten von dem bevorstehenden Angriff und schafften es, die wertvollsten Schätze unter den Schutz der örtlichen Behörden zu bringen. Vielleicht war der Teppich von Bayeux gut versteckt, oder die Diebe haben ihn einfach übersehen; aber es gelang ihm, dem Tod zu entgehen.

Eines der Buntglasfenster der Kathedrale.
Stürmische Zeiten wichen friedlichen und die Tradition, an Feiertagen einen Wandteppich aufzuhängen, wurde wiederbelebt. Als Ersatz für die Flugkleidung und die spitzen Hüte des XIV. Jahrhunderts. Enge Hosen und Perücken kamen an, aber die Einwohner von Bayeux blickten immer noch voller Bewunderung auf den Wandteppich, der den Sieg der Normannen darstellte. Erst im 18. Jahrhundert. Wissenschaftler machten darauf aufmerksam, und von diesem Moment an ist die Geschichte des Teppichs von Bayeux im Detail bekannt, obwohl die Kette der Ereignisse, die zur „Entdeckung“ des Teppichs führten, nur allgemein gehalten ist.
Die Geschichte der „Entdeckung“ beginnt mit Nicolas-Joseph Faucolt, dem Herrscher der Normandie von 1689 bis 1694. Er war ein sehr gebildeter Mann und nach seinem Tod im Jahr 1721 wurden seine Nachlässe in die Pariser Bibliothek überführt. Darunter befanden sich stilisierte Zeichnungen des ersten Teils des Teppichs von Bayeux. Die Pariser Antiquare waren von diesen rätselhaften Zeichnungen fasziniert. Ihr Autor ist unbekannt, es ist jedoch möglich, dass er die Tochter Focolts war, die für ihre künstlerischen Talente berühmt war. Im Jahr 1724 machte der Entdecker Anthony Lancelot (1675 – 1740) die Royal Academy auf diese Zeichnungen aufmerksam. In einer wissenschaftlichen Zeitschrift reproduzierte er Facolts Aufsatz; Das. Zum ersten Mal erschien das Bild des Teppichs von Bayeux in gedruckter Form, aber noch wusste niemand, was es wirklich war. Lancelot verstand, dass die Zeichnungen ein herausragendes Kunstwerk darstellten, hatte aber keine Ahnung, welches. Er konnte nicht bestimmen, was es war: ein Basrelief, eine skulpturale Komposition auf dem Chor einer Kirche oder einem Grab, ein Fresko, ein Mosaik oder ein Wandteppich. Er stellte lediglich fest, dass Focolts Werk nur einen Teil eines größeren Werks beschrieb, und kam zu dem Schluss, dass „es eine Fortsetzung haben muss“, obwohl der Forscher sich nicht vorstellen konnte, wie lang es sein könnte. Der benediktinische Historiker Bernard de Montfaucon (1655-1741) entdeckte die Wahrheit über den Ursprung dieser Zeichnungen. Er war mit dem Werk von Lancelot vertraut und machte es sich zur Aufgabe, ein geheimnisvolles Meisterwerk zu finden. Im Oktober 1728 traf sich Montfaucon mit dem Rektor der Abtei St. Vigor in Bayeux. Der Rektor war ein Anwohner und sagte, dass die Zeichnungen antike Stickereien zeigten, die an bestimmten Tagen in der Bayes-Kathedrale aufgehängt würden. So wurde ihr Geheimnis gelüftet und der Wandteppich wurde Eigentum der gesamten Menschheit.
Wir wissen nicht, ob Montfaucon den Wandteppich mit eigenen Augen gesehen hat, obwohl es schwer vorstellbar ist, dass er diese Gelegenheit verpasst hat, nachdem er sich so viel Mühe bei der Suche gegeben hat. 1729 veröffentlichte er Focolts Zeichnungen im ersten Band der Monuments of the French Monasteries. Anschließend bat er Anthony Benois, einen der besten Zeichner seiner Zeit, den Rest des Wandteppichs ohne Änderungen zu kopieren. Im Jahr 1732 erschienen Benois‘ Zeichnungen im zweiten Band von Montfaucons Monumenten. Daher wurden alle auf dem Wandteppich dargestellten Episoden gedruckt. Diese ersten Bilder des Wandteppichs sind sehr wichtig: Sie zeugen vom Zustand des Wandteppichs in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt waren die letzten Episoden der Stickerei bereits verloren gegangen, sodass Benoits Zeichnungen mit demselben Fragment enden, das wir heute sehen können. In seinem Kommentar heißt es, dass die lokale Tradition die Entstehung des Wandteppichs der Frau von Wilhelm dem Eroberer, Königin Matilda, zuschreibt. Daher entstand hier auch der weit verbreitete Mythos vom „Wandteppich der Königin Matilda“.

Königin Matilda.
Unmittelbar nach diesen Veröffentlichungen griffen eine Reihe von Wissenschaftlern aus England auf den Wandteppich zurück. Einer der ersten unter ihnen war der Antiquar Andrew Ducarel (1713 – 1785), der den Wandteppich 1752 sah. Es erwies sich als schwierige Aufgabe, ihn zu erreichen. Ducarel hörte von der Bayes’schen Stickerei und wollte sie sehen, doch als er in Bayeux ankam, leugneten die Priester der Kathedrale rundweg deren Existenz. Vielleicht wollten sie den Wandteppich einfach nicht für gelegentliche Reisende ausrollen. Aber Ducarel würde nicht so schnell aufgeben. Er sagte, dass der Wandteppich die Eroberung Englands durch Wilhelm den Eroberer darstellte und fügte hinzu, dass er jedes Jahr in ihrer Kathedrale aufgehängt werde. Diese Information weckte die Erinnerung an die Priester. Die Beharrlichkeit des Wissenschaftlers wurde belohnt: Er wurde in eine kleine Kapelle im südlichen Teil der Kathedrale geführt, die dem Andenken an Thomas Beckett gewidmet war. Hier wurde in einer Eichenkiste der gefaltete Bayesianische Wandteppich aufbewahrt. Ducarel war einer der ersten Engländer, der den Wandteppich nach dem 11. Jahrhundert sah. Später schrieb er über die tiefe Befriedigung, die er empfand, als er diese „unglaublich wertvolle“ Schöpfung sah; obwohl er seine „barbarische Sticktechnik“ beklagte. Der Standort des Wandteppichs blieb jedoch für die meisten Gelehrten ein Rätsel, und der große Philosoph David Hume verwirrte die Situation noch mehr, als er schrieb: „Dieses interessante und originelle Denkmal wurde kürzlich in Rouen entdeckt.“ Doch nach und nach verbreitete sich der Ruhm des Teppichs von Bayeux auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Es stimmt, er hatte schwere Zeiten vor sich. Er überstand das dunkle Mittelalter in hervorragender Verfassung, doch nun stand er vor der schwersten Prüfung seiner Geschichte.

Souvenir-T-Shirt mit Gobelin-Symbolen.
Der Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 zerstörte die Monarchie und löste die Brutalität der Französischen Revolution aus. Die alte Welt der Religion und Aristokratie wurde nun von den Revolutionären völlig abgelehnt. Im Jahr 1792 beschloss die Revolutionsregierung Frankreichs, dass alles, was mit der Geschichte des Königshauses zu tun hatte, zerstört werden sollte. In einem Anfall von Bildersturm stürzten Gebäude ein, Skulpturen stürzten ein, unbezahlbare Buntglasfenster französischer Kathedralen zersprangen in Stücke. Beim Pariser Brand von 1793 brannten 347 Bände und 39 Kisten mit historischen Dokumenten nieder. Bald erreichte eine Welle der Zerstörung Bayeux.
Im Jahr 1792 zog eine weitere Gruppe lokaler Bürger in den Krieg, um die Französische Revolution zu verteidigen. In aller Eile vergaßen sie die Plane, die den Wagen mit der Ausrüstung bedeckte. Und jemand riet, zu diesem Zweck die Stickerei von Königin Matilda zu verwenden, die in der Kathedrale aufbewahrt wurde! Die örtliche Verwaltung stimmte zu, und eine Schar Soldaten drang in die Kathedrale ein, beschlagnahmte den Wandteppich und bedeckte damit den Wagen. Der örtliche Polizeikommissar, Rechtsanwalt Lambert Leonard-Leforester, erfuhr davon im allerletzten Moment. Da er den enormen historischen und künstlerischen Wert des Wandteppichs kannte, ordnete er sofort an, ihn an seinen Platz zurückzubringen. Dann eilte er voller Furchtlosigkeit zum Wagen mit dem Wandteppich und ermahnte die Soldatenmenge persönlich, bis sie sich bereit erklärten, den Wandteppich gegen eine Plane zurückzugeben. Einige Revolutionäre hegten jedoch weiterhin die Idee, den Wandteppich zu zerstören, und versuchten 1794, ihn in Stücke zu schneiden, um ein festliches Floß zu Ehren der „Göttin der Vernunft“ zu schmücken. Doch zu diesem Zeitpunkt befand er sich bereits in den Händen der örtlichen Kunstkommission, und es gelang ihr, den Wandteppich vor der Zerstörung zu bewahren.
In der Ära des Ersten Kaiserreichs war das Schicksal des Wandteppichs glücklicher. Zu dieser Zeit zweifelte niemand daran, dass es sich bei dem Bayes'schen Wandteppich um eine Stickerei der Frau eines siegreichen Eroberers handelte, die die Errungenschaften ihres Mannes verherrlichen wollte. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Napoleon Bonaparte in ihm ein Mittel sah, die Wiederholung derselben Eroberung zu propagieren. Im Jahr 1803 plante der damalige Erste Konsul eine Invasion Englands und um die Begeisterung zu schüren, ordnete er an, den „Wandteppich der Königin Matilda“ im Louvre (damals Napoleon-Museum genannt) auszustellen. Der Wandteppich befand sich jahrhundertelang in Bayeux, und die Stadtbewohner trennten sich bitterlich von einem Meisterwerk, das sie vielleicht nie wieder sehen würden. Aber die örtlichen Behörden konnten sich dem Befehl nicht widersetzen und der Wandteppich wurde nach Paris geschickt.

Der Louvre in Paris, wo der Wandteppich mehrmals ausgestellt wurde.
Die Ausstellung in Paris war ein großer Erfolg, der Wandteppich wurde zu einem beliebten Diskussionsthema in weltlichen Salons. Es wurde sogar ein Theaterstück geschrieben, in dem Königin Matilda hart an dem Wandteppich arbeitete, und eine fiktive Figur namens Raymond träumte davon, ein Heldensoldat zu werden, damit auch er auf den Wandteppich gestickt würde. Es ist nicht bekannt, ob Napoleon dieses Stück gesehen hat, es wird jedoch angegeben, dass er mehrere Stunden in Gedanken vor dem Wandteppich gestanden hat. Wie Wilhelm der Eroberer bereitete er sich sorgfältig auf die Invasion Englands vor. Napoleons Flotte aus 2.000 Schiffen befand sich zwischen Brest und Antwerpen, und seine „große Armee“ von 150.000 bis 200.000 Soldaten lagerte in Bologna. Die historische Parallele wurde noch deutlicher, als ein Komet durch den Himmel über Nordfrankreich und Südengland zog, wie der Teppich von Bayeux deutlich zeigt, der Halleysche Komet, gesehen im April 1066. Diese Tatsache blieb nicht unbemerkt und viele betrachteten sie als ein weiteres Omen der Niederlage. England. Doch trotz aller Anzeichen gelang es Napoleon nicht, den Erfolg des Herzogs der Normandie zu wiederholen. Seine Pläne wurden nicht verwirklicht und 1804 kehrte der Wandteppich nach Bayeux zurück. Diesmal landete es in den Händen weltlicher und nicht kirchlicher Autoritäten. Er stellte nie wieder in der Bayes Cathedral aus.
Als 1815 zwischen England und Frankreich Frieden geschlossen wurde, hörte der Teppich von Bayeux auf, als Propagandainstrument zu dienen, und kehrte in die Welt der Wissenschaft und Kunst zurück. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde den Menschen klar, wie nahe der Tod des Meisterwerks war, und sie dachten über den Ort seiner Lagerung nach. Viele waren besorgt über die Art und Weise, wie der Wandteppich ständig auf- und abgerollt wurde. Das allein tat ihm weh, aber die Behörden hatten es nicht eilig, dieses Problem zu lösen. Um den Wandteppich zu bewahren, schickte die London Society of Antiquaries Charles Stozard, einen bedeutenden Zeichner, mit der Kopie. Zwei Jahre lang, von 1816 bis 1818, arbeitete Stozard an diesem Projekt. Seine Zeichnungen sind zusammen mit früheren Bildern von großer Bedeutung für die Beurteilung des damaligen Zustands des Wandteppichs. Aber Stozard war nicht nur ein Künstler. Er schrieb einen der besten Kommentare zum Wandteppich. Darüber hinaus versuchte er, die verlorenen Episoden auf Papier wiederherzustellen. Seine Arbeit half später bei der Restaurierung des Wandteppichs. Stozard war sich der Notwendigkeit dieser Arbeit klar bewusst. „Es werden noch einige Jahre vergehen“, schrieb er, „und es wird nicht mehr möglich sein, diese Arbeit zu vollenden.“
Doch leider zeigte die letzte Phase der Arbeit an dem Wandteppich die Schwäche der menschlichen Natur. Als Stozard lange Zeit allein mit dem Meisterwerk war, erlag er der Versuchung und schnitt als Andenken ein Stück des oberen Randes (2,5 x 3 cm) ab. Im Dezember 1816 brachte er heimlich ein Souvenir nach England und fünf Jahre später starb er auf tragische Weise – er stürzte aus dem Wald der Kirche von Bere Ferrers in Devon. Stozards Erben schenkten das Stück dem Victoria and Albert Museum in London, wo es als „Teil des Bayesianischen Wandteppichs“ ausgestellt wurde. Im Jahr 1871 beschloss das Museum, das „verlorene“ Stück an seinen wahren Platz zurückzubringen. Es wurde nach Bayeux gebracht, aber zu diesem Zeitpunkt war der Wandteppich bereits restauriert. Es wurde beschlossen, das Fragment in derselben Glasbox zu belassen, in der es aus England angekommen war, und es neben dem restaurierten Bordstein zu platzieren. Alles wäre gut, aber es verging kein Tag, an dem nicht jemand den Bewahrer nach diesem Fragment und dem englischen Kommentar dazu fragte. Infolgedessen war die Geduld des Kurators erschöpft und ein Stück Wandteppich wurde aus der Ausstellungshalle entfernt.
Es gibt eine Geschichte, die besagt, dass Stozards Frau und ihre „schwache weibliche Natur“ für den Diebstahl eines Wandteppichfragments verantwortlich sind. Aber heute zweifelt niemand mehr daran, dass Stozard selbst der Dieb war. Und er war nicht der letzte, der zumindest ein Stück des antiken Wandteppichs mitnehmen wollte. Einer seiner Anhänger war Thomas Diblin, der den Wandteppich im Jahr 1818 besuchte. In seinem Buch mit Reiseberichten schreibt er selbstverständlich, dass er, obwohl er Schwierigkeiten hatte, an den Wandteppich heranzukommen, mehrere Streifen abgeschnitten habe. Das Schicksal dieser Patches ist nicht bekannt. Der Wandteppich selbst wurde 1842 in ein neues Gebäude verlegt und schließlich unter den Schutz von Glas gestellt.
Der Ruhm des Teppichs von Bayeux wuchs weiter, vor allem dank der gedruckten Reproduktionen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen. Aber eine gewisse Elizabeth Wardle war nicht genug. Sie war die Frau eines wohlhabenden Seidenhändlers und entschied, dass England etwas Greifbareres und Bleibenderes als Fotografien verdiente. Mitte der 1880er Jahre. Frau Wardle versammelte eine Gruppe von 35 Gleichgesinnten und machte sich daran, eine exakte Kopie des Teppichs von Bayeux anzufertigen. Nach 800 Jahren wiederholte sich die Handlung der Bayes'schen Stickerei erneut. Es dauerte zwei Jahre, bis die viktorianischen Damen ihre Arbeit abgeschlossen hatten. Das Ergebnis war großartig und sehr genau, ähnlich dem Original. Allerdings konnten sich die steifen britischen Damen nicht dazu durchringen, einige Details mitzuteilen. Bei der Darstellung männlicher Genitalien (deutlich auf dem Wandteppich eingestickt) wich die Authentizität der Schüchternheit. Auf ihrer Kopie beschlossen die viktorianischen Näherinnen, einer nackten Figur ihre Männlichkeit zu entziehen, während die andere klugerweise Unterhosen trug. Doch nun erregt im Gegenteil das, was sie bescheiden unfreiwillig vertuschen wollten, besondere Aufmerksamkeit. Die Kopie wurde 1886 fertiggestellt und ging auf eine triumphale Ausstellungstournee durch England, dann die USA und Deutschland. 1895 wurde diese Kopie der Stadt Reading gespendet. Bis heute befindet sich die britische Version des Bayesianischen Wandteppichs im Museum dieser englischen Stadt.
Deutsch-Französischer Krieg 1870 - 1871 sowie der Erste Weltkrieg hinterließen keine Spuren auf dem Teppich von Bayeux. Doch während des Zweiten Weltkriegs erlebte der Wandteppich eines der größten Abenteuer seiner Geschichte. Am 1. September 1939, gerade als deutsche Truppen in Polen einmarschierten und Europa fünfeinhalb Jahre lang in die Dunkelheit des Krieges stürzten, wurde der Wandteppich vorsichtig aus seinem Ausstellungsständer genommen, aufgerollt, mit Insektiziden besprüht und in einem Betonschutz versteckt in den Fundamenten des Bischofspalastes in Bayeux. Hier wurde der Wandteppich ein ganzes Jahr lang aufbewahrt, wobei er nur gelegentlich überprüft und erneut mit Insektiziden besprüht wurde. Im Juni 1940 fiel Frankreich. Und fast sofort wurden die Besatzungsbehörden auf den Wandteppich aufmerksam. Zwischen September 1940 und Juni 1941 wurde der Wandteppich mindestens zwölf Mal dem deutschen Publikum gezeigt. Wie Napoleon hofften die Nazis, den Erfolg Wilhelms des Eroberers zu wiederholen. Wie Napoleon betrachteten sie den Wandteppich als Propagandainstrument und verzögerten wie Napoleon die Invasion im Jahr 1940. Churchills Großbritannien war besser auf den Krieg vorbereitet als Harolds. Großbritannien gewann den Luftkrieg und obwohl das Land weiterhin bombardiert wurde, richtete Hitler seine Hauptstreitkräfte gegen die Sowjetunion.
Das deutsche Interesse am Teppich von Bayeux ließ jedoch nicht nach. Im Ahnenerbe – der Forschungs- und Bildungsabteilung der deutschen SS – begann man sich für Wandteppiche zu interessieren. Der Zweck dieser Organisation besteht darin, „wissenschaftliche“ Beweise für die Überlegenheit der arischen Rasse zu finden. Das Ahnenerbe zog eine beeindruckende Zahl deutscher Historiker und Wissenschaftler an, die bereitwillig eine wirklich wissenschaftliche Karriere zugunsten der Nazi-Ideologie aufgaben. Diese Organisation ist für ihre unmenschlichen medizinischen Experimente in Konzentrationslagern berüchtigt, engagierte sich aber sowohl in der Archäologie als auch in der Geschichte. Selbst in den schwierigsten Zeiten des Krieges gab die SS riesige Summen für das Studium der deutschen Geschichte und Archäologie, des Okkultismus und der Suche nach Kunstwerken arischer Herkunft aus. Der Wandteppich erregte ihre Aufmerksamkeit dadurch, dass er die militärische Stärke der nordischen Völker darstellte – der Normannen, der Nachkommen der Wikinger und Angelsachsen, der Nachkommen der Angeln und Sachsen. Deshalb entwickelten die „Intellektuellen“ der SS ein ehrgeiziges Projekt zur Untersuchung des Bayes'schen Wandteppichs, bei dem sie beabsichtigten, ihn in seiner Gesamtheit zu fotografieren und neu zu zeichnen und die daraus resultierenden Materialien dann zu veröffentlichen. Die französischen Behörden mussten sich ihnen unterwerfen.

Wahrscheinlich gibt es in fast jedem örtlichen Souvenirladen Elastolin-Figuren normannischer Reiter.
Zu Studienzwecken wurde der Wandteppich im Juni 1941 in die Abtei Juan-Mondoyer transportiert. Die Forschergruppe wurde von Dr. Herbert Jankuhn, Professor für Archäologie aus Kiel und aktivem Mitglied des Ahnenerbes, geleitet. Jankuhn hielt am 14. April 1941 vor Hitlers „Freundeskreis“ und auf dem Kongress der Deutschen Akademie in Stettin im August 1943 Vorträge über den Bayes’schen Wandteppich. Nach dem Krieg setzte er seine wissenschaftliche Karriere fort und veröffentlichte häufig in der „Geschichte der“. Mittelalter. Viele Studenten und Wissenschaftler haben seine Arbeit gelesen und zitiert, ohne sich seiner zweifelhaften Vergangenheit bewusst zu sein. Im Laufe der Zeit wurde Jankuhn emeritierter Professor in Göttingen. Er starb 1990 und sein Sohn schenkte die Werke des Bayesianischen Wandteppichs dem Museum, wo sie bis heute einen wichtigen Teil seines Archivs bilden.
In der Zwischenzeit stimmten die Deutschen auf Anraten der französischen Behörden aus Sicherheitsgründen zu, den Wandteppich in das Kunstdepot im Château de Surche zu verlegen. Dies war eine kluge Entscheidung, da das Schloss, ein großer Palast aus dem 18. Jahrhundert, weit vom Operationsgebiet entfernt lag. Der Bürgermeister von Bayeux, Señor Daudément, bemühte sich nach Kräften, das richtige Fahrzeug für den Transport des Meisterwerks zu finden. Doch leider gelang es ihm nur, einen sehr unzuverlässigen und sogar gefährlichen Lastwagen mit einem Gasgeneratormotor mit einer Leistung von nur 10 PS zu bekommen, der mit Kohle betrieben wurde. Ein Meisterwerk, 12 Säcke Kohle, wurde hineingeladen, und am Morgen des 19. August 1941 begann die unglaubliche Reise des berühmten Wandteppichs.

Technik zum Sticken von Bildern auf einen Wandteppich.
Zuerst war alles in Ordnung. Der Fahrer und zwei Begleiter hielten zum Mittagessen in der Stadt Flers an, doch als sie wieder losfahren wollten, sprang der Motor nicht an. Nach 20 Minuten startete der Fahrer das Auto und sie sprangen hinein, aber dann ging der Motor beim ersten Anstieg kaputt und sie mussten aus dem Lastwagen aussteigen und ihn bergauf schieben. Dann raste das Auto bergab und sie rannten hinter ihm her. Diese Übung mussten sie viele Male wiederholen, bis sie mehr als 100 Meilen zwischen Baye und Surchet zurückgelegt hatten. Am Ziel angekommen hatten die erschöpften Helden keine Zeit zum Ausruhen oder Essen. Sobald sie den Wandteppich abgeladen hatten, fuhr das Auto zurück nach Bayeux, wo sie wegen einer strengen Ausgangssperre vor 22 Uhr dort sein mussten. Obwohl der Lkw leichter wurde, kam er dennoch nicht bergauf. Um 21 Uhr hatten sie nur Alención erreicht, eine Stadt auf halber Höhe von Bayeux. Die Deutschen führten die Evakuierung der Küstengebiete durch, die von Flüchtlingen überfüllt waren. Es gab keine Plätze in Hotels, Essen in Restaurants und Cafés. Schließlich hatte der Concierge der Stadtverwaltung Mitleid mit ihnen und ließ sie auf den Dachboden, der auch als Kammer für Spekulanten diente. In der Nahrung fand er Eier und Käse. Erst am nächsten Tag, nach viereinhalb Stunden, kehrten alle drei nach Bayeux zurück, gingen aber sofort zum Bürgermeister und berichteten, dass der Wandteppich die besetzte Normandie sicher überquert habe und eingelagert sei. Dort lag er weitere drei Jahre.
Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie, und es schien, als spiegelten sich die Ereignisse von 1066 im Spiegel der Geschichte genau im Gegenteil wider: Nun überquerte eine riesige Flotte mit Soldaten an Bord den Ärmelkanal, allerdings in die entgegengesetzte Richtung und mit dem Ziel der Befreiung und nicht der Eroberung. Trotz heftiger Kämpfe hatten die Alliierten Schwierigkeiten, für die Offensive wieder Fuß zu fassen. Surche lag 100 Meilen von der Küste entfernt, dennoch beschlossen die deutschen Behörden mit Zustimmung des französischen Bildungsministers, den Wandteppich nach Paris zu verlegen. Es wird angenommen, dass Heinrich Himmler selbst hinter dieser Entscheidung stand. Von allen unschätzbaren Kunstwerken, die im Château de Surche aufbewahrt werden, wählte er nur den Wandteppich aus. Und am 27. Juni 1944 wurde der Wandteppich in die Keller des Louvre gebracht.

Panzer „Sherman“ – ein Denkmal für die Befreiung von Bayeux.
Ironischerweise wurde Bayeux lange bevor der Wandteppich in Paris ankam, freigelassen. Am 7. Juni 1944, einen Tag nach der Landung, nahmen die Alliierten der 56. britischen Infanteriedivision die Stadt ein. Bayeux war die erste Stadt Frankreichs, die von den Nazis befreit wurde, und im Gegensatz zu vielen anderen wurden ihre historischen Gebäude durch den Krieg nicht beschädigt. Auf dem britischen Kriegsfriedhof befindet sich eine lateinische Inschrift, die besagt, dass diejenigen, die von Wilhelm dem Eroberer erobert wurden, zurückgekehrt sind, um das Heimatland des Eroberers zu befreien. Wäre der Wandteppich in Bayeux geblieben, wäre er viel früher freigegeben worden.
Im August 1944 näherten sich die Alliierten dem Stadtrand von Paris. Eisenhower, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, hatte die Absicht, an Paris vorbeizukommen und in Deutschland einzumarschieren, aber der Anführer der französischen Befreiungsbewegung, General de Gaulle, befürchtete, dass Paris in die Hände der Kommunisten fallen würde, und bestand auf einem schnellen Vorgehen Befreiung der Hauptstadt. In den Vororten begannen Schlachten. Von Hitler erhielt er den Befehl, die Hauptstadt Frankreichs im Falle eines Verlassens vom Erdboden zu wischen. Zu diesem Zweck wurden die Hauptgebäude und Brücken von Paris vermint und Hochleistungstorpedos in den U-Bahn-Tunneln versteckt. General Choltitz, der die Pariser Garnison befehligte, stammte aus einer alten preußischen Militärfamilie und konnte den Befehl in keiner Weise verletzen. Zu diesem Zeitpunkt erkannte er jedoch, dass Hitler verrückt war, dass Deutschland den Krieg verlieren würde, und er spielte auf jede erdenkliche Weise auf Zeit. Unter diesen und jenen Umständen betraten am Montag, dem 21. August 1944, plötzlich zwei SS-Männer sein Büro im Maurice Hotel. Der General entschied, dass es für ihn sei, aber er täuschte sich. Die SS-Männer sagten, sie hätten von Hitler den Befehl erhalten, den Wandteppich nach Berlin zu bringen. Es ist möglich, dass es zusammen mit anderen nordischen Reliquien in einem quasi-religiösen Heiligtum der SS-Elite untergebracht werden sollte.

Britischer Militärfriedhof.
Der General zeigte ihnen vom Balkon aus den Louvre, in dessen Keller der Wandteppich aufbewahrt wurde. Der berühmte Palast befand sich bereits in den Händen der französischen Widerstandskämpfer und auf der Straße feuerten Maschinengewehre. Die SS dachte darüber nach und einer von ihnen sagte, dass die französischen Behörden den Wandteppich höchstwahrscheinlich bereits entfernt hätten und es keinen Sinn habe, das Museum im Sturm zu erobern. Nachdem sie eine Weile nachgedacht hatten, beschlossen sie, mit leeren Händen zurückzukehren.
Strg Eingeben
Habe es bemerkt, Osch s bku Markieren Sie den Text und klicken Sie Strg+Eingabetaste